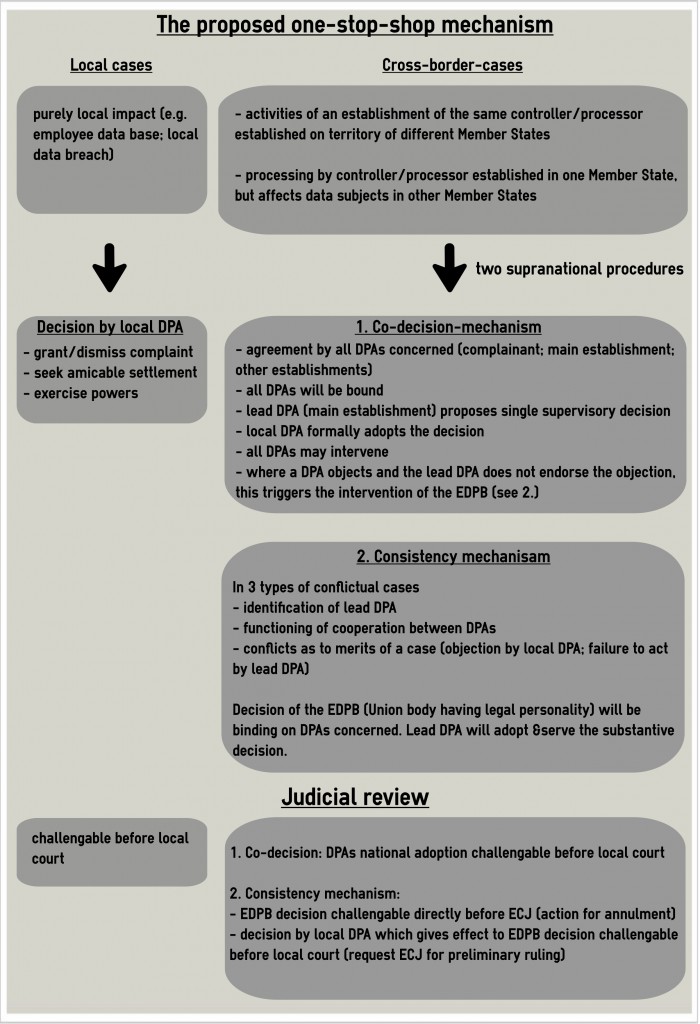Die Artikel 29 Datenschutzgruppe (Art. 29 Gruppe), das Gremium der Vertreter der europäischen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz, hat in einer neuen Stellungnahme (WP 223, PDF) zum „Internet der Dinge“ (IoT) ihre Positionen zu verschiedenen datenschutzrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung rund um Smartwatches, Fitnesstracker oder intelligente Thermostate dargelegt. Im Folgenden möchte ich einige der in der Stellungnahme angesprochenen Themenbereiche näher beleuchten.
Räumlicher Anwendungsbereich
Nach Ansicht der Art. 29 Gruppe ist das europäischen Datenschutzrecht (bzw. die jeweilige nationale Umsetzung der Vorgaben der geltenden Datenschutzrichtlinie (DS-RL) 95/46/EG) zum einen dann anwendbar, wenn Datenverarbeitungen „im Rahmen der Tätigkeiten“ einer Niederlassung ausgeführt werden, die der für die Verarbeitung Verantwortliche (hierzu sogleich) in der Europäischen Union besitzt (Art. 4 Abs. 1 lit. a DS-RL). Was genau unter der Umschreibung „im Rahmen der Tätigkeiten“ zu verstehen ist, wird in dieser Stellungnahme nicht näher erläutert. Jedoch verweisen die Datenschützer auf das Google-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (C-131/12) und die dort vorgenommene sehr weite (meines Erachtens mit dem Wortlaut der Datenschutzrichtlinie kaum zu vereinbarende) Auslegung dieses Begriffs. Sollte der für die Datenverarbeitung Verantwortliche nicht in der EU niedergelassen sein, ist das europäische Datenschutzrecht dennoch anwendbar, wenn er nach Art. 4 Abs. 1 lit. c DS-RL auf Mittel zurückgreift, welche in einem Mitgliedstaat belegen sind. Nach Ansicht der Datenschützer stellen alle Geräte, die zur Erhebung oder weiteren Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen eines IoT-Dienstes eingesetzt werden, solche „Mittel“ im Sinne der DS-RL dar. Hierzu gehören aber auch die Smartphones oder Tablets der Nutzer, auf denen entsprechende Software oder Apps zum Analysieren oder Übermitteln der erhobenen Daten installiert sind.
Personenbezogene Daten
Für die Datenschützer sind die Informationen, die von den IoT-Geräten erhoben werden, in den meisten Fällen als personenbezogen im Sinne des Art. 2 DS-RL anzusehen. Entweder kann eine bestimmte Person direkt hierüber identifiziert oder es können Lebensmuster und –gewohnheiten einer Person oder Familie erkannt werden. Jedoch gehen die Datenschützer in ihrer Stellungnahme noch weiter. Selbst wenn Daten pseudonymisiert oder gar anonymsiert werden, so bestünde doch aufgrund der Schieren Menge an Informationen stets ein latentes Risiko einer Re-Identifizierung. Dies reiche aus, um von personenbezogenen Daten auszugehen.
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher
Bei der Frage des für die Verarbeitung Verantwortlichen geht es um die Bestimmung derjenigen Stelle, welche die gesetzlichen Pflichten des Datenschutzrechts treffen. Die Art. 29 Gruppe verweist darauf, dass im Bereich des Internet der Dinge viele verschiedene Spieler beteiligt sind und daher eine genaue Analyse Ihrer Beteiligungen an den jeweiligen Datenverarbeitungsprozessen vorzunehmen ist. Der Gerätehersteller ist nach Ansicht der Datenschützer vor allem dann für die Datenverarbeitung verantwortlich, wenn er nicht nur das physische Gerät verkauft, sondern auch die Software programmiert und damit vorgibt, wie und welche Daten erhoben und zu welchen Zwecken verarbeitet werden. Auch Internetplattformen, auf denen Nutzer die über das Gerät erhoben Daten teilen und veröffentlichen können, besitzen unter gewissen Umständen datenschutzrechtliche Pflichten. So ist etwa der Anbieter eines sozialen Netzwerkes nach Ansicht der Datenschützer dann als Verantwortlicher anzusehen, wenn er Daten aus dem IoT-Gerät eines Nutzers für eigene Zwecke verwendet, z.B. um personalisierte Werbung für passionierte Jogger auszuspielen. Und auch Anbieter von Drittdiensten, etwa speziellen Apps, die auf IoT-Daten zugreifen, sind als für die Verarbeitung Verantwortlichen anzusehen, wenn sie über eine vorhandene API auf Informationen auf dem jeweiligen Gerät zugreifen. Nach Ansicht der Art. 29 Gruppe bedarf es hierfür zumeist der Einwilligung des Betroffenen, welche im Rahmen des Installationsprozesses der App einzuholen ist.
Einwilligung nach der ePrivacy-Richtlinie
Die Art. 29 Gruppe weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass neben den Regelungen der DS-RL auch einzelne Bestimmungen anderer Gesetze zur Anwendung kommen können. Insbesondere im Blick haben die Datenschützer hierbei Art. 5 Abs. 3 der sog. ePrivacy-Richtlinie (2002/58/EG). Danach ist die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen, die bereits im Endgerät eines Nutzers gespeichert sind, nur gestattet, wenn der betreffende Nutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen seine Einwilligung gegeben hat. Dieses Einwilligungserfordernis betrifft nach Ansicht der Datenschützer vor allem den Gerätehersteller. Zu beachten ist, dass die Einwilligung sich nicht nur auf personenbezogene Daten bezieht, sondern ganz allgemein auf Informationen, die in einem IoT-Gerät gespeichert sind.
Erlaubnistatbestände der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die über ein IoT-Gerät erhoben werden, bedarf nach dem geltenden Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt eines Erlaubnistatbestandes. Art. 7 DS-RL listet die möglichen gesetzlichen Grundlagen einer Verarbeitung personenbezogener Daten auf. Die Voraussetzungen einer der Alternativen des Art. 7 DS-RL sind neben den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtlinie zu erfüllen (der ja bereits bei einem Zugriff auf Informationen einschlägig ist). Nach Ansicht der Art. 29 Gruppe kommen im Rahmen des Einsatzes von IoT-Geräten vor allem drei Varianten des Art. 7 DS-RL in Betracht. Zum einen Art. 7 lit. a DS-RL, wenn der Betroffene seine Einwilligung in die Datenverarbeitung erteilt hat. Zum anderen Art. 7 lit. b DS-RL, wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist. Die Art. 29 Gruppe weist darauf hin, dass der Anwendungsbereich dieses Erlaubnistatbestandes durch das Merkmal der „Erforderlichkeit“ begrenzt ist. Zum Dritten stellt auch Art. 7 lit. f DS-RL einen tauglichen Erlaubnistatbestand dar, wenn die Verarbeitung zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, das von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von dem bzw. den Dritten wahrgenommen wird erforderlich ist. Dies jedoch nur, sofern nicht das Interesse oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. In diesem Zusammenhang verweisen die Datenschützer erneut auf das Google-Urteil des EuGH und nehmen die Aussagen des Gerichts zum Anlass darauf einzugehen, dass eine Datenverarbeitung über IoT-Geräte sehr wahrscheinlich die Grundrechte auf Privatleben und den Schutz personenbezogener Daten in besonderer Weise berührt. Die Daten beziehen sich etwa auf die Gesundheit der Betroffenen oder ihre private Umgebung. Nach Ansicht der Art. 29 Gruppe ist eine Datenverarbeitung unter diesen Gegebenheiten kaum allein durch die wirtschaftlichen Interessen des jeweils Verantwortlichen zu rechtfertigen.
Zusammenfassung
Die Stellungnahme der Art. 29 Gruppe geht noch auf weitere Aspekte ein, etwa Anforderungen an die Datenqualität, die Verarbeitung besonderer Arten von personenbezogenen Daten (z. B. Gesundheitsdaten) oder auch zu ergreifende technische und organisatorische Maßnahmen, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Insgesamt dient die Stellungnahme der Datenschützer sicherlich als informative Lektüre, um eine grobe Einschätzung des immer bedeutender werdenden Bereichs des Internets der Dinge aus Sicht der Aufsichtsbehörden zu erhalten. Meines Erachtens sind die Positionen der Art. 29 Gruppe freilich nicht in jedem Punkt las eine Art „obiter dictum“ hinzunehmen. So stellt sich etwa für Geräte- oder Softwarehersteller die Frage des Sinns (bzw. Unsinns) von Anonymisierungsverfahren, wenn nach Ansicht der Datenschützer selbst dann die datenschutzrechtlichen Pflichten eingreifen. Als ob also eine Anonymisierung von Daten gar nicht stattgefunden hätte. Warum sollten Unternehmen dann noch eine Anonymisierung (die mit tatsächlichen und finanziellen Aufwandverbunden ist) vornehmen? Auch in Zukunft werden das vernetzte Haus, das smarte Auto oder die intelligenten Uhren den Datenschutz vor Herausforderungen stellen. Es sollte daher auch genau auf eine mögliche Berücksichtigung dieser Technologien in der geplanten Datenschutz-Grundverordnung geachtet werden und wie das künftige Datenschutzrecht mit technologischen Entwicklungen umgehen wird.